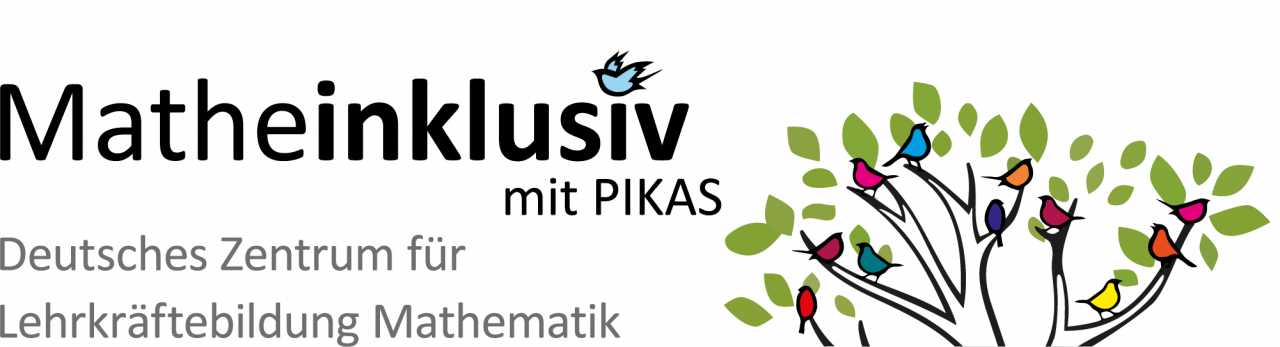Genetische und neuronale Faktoren
Im alltäglichen Erleben gewinnt man oft den Eindruck, dass Rechenschwierigkeiten vor allem in bestimmten Familien auftreten und nicht selten schließt man auf deren Erblichkeit. Ein solcher Schluss ist meist voreilig, denn in Familien wird nicht nur die genetische Anlage an die Kinder weitergegeben, sondern auch die familiäre Lernumwelt und bestimmte soziale und kulturelle Entwicklungsbedingungen.
Empirische Studien wie die von Kovas, Haworth, Dale und Plomin (2007) legen eine vorsichtigere und differenziertere Bewertung nahe. Zwar konnte gezeigt werden, dass Rechenschwierigkeiten familiär gehäuft auftreten und dass sich für diesen Befund ein genetischer Beitrag feststellen lässt, aber es konnten bislang keine spezifischen Gene identifiziert werden und die Überschneidungen mit Aufmerksamkeitsstörungen und mit schriftsprachlichen Lernschwierigkeiten waren sehr groß (Aster, 2005).
Grundsätzlich muss man sich ohnehin fragen, ob die Suche nach den genetischen Anteilen an der Entstehung von Rechenschwierigkeiten pädagogisch wichtig ist. Wie hoch auch immer dieser Anteil sein mag, die genetische Ausstattung eines Kindes lässt sich nicht verändern – helfen kann man den betroffenen Kindern nur mit pädagogischen Mitteln. Ob und in welchem Ausmaß sich guter, individuell angepasster Mathematikunterricht als hilfreich erweist, kann nur in mathematikdidaktischer und pädagogischer Forschung geklärt werden (Stern, 2005).
Überhaupt darf man die Ursachen von Lernschwierigkeiten nicht mit deren pädagogischer Beeinflussbarkeit verwechseln: Falls eine Störung genetische Ursachen hat, sagt das noch nichts über deren Modifizierbarkeit aus. Das gilt ebenso für die neuronalen Grundlagen von Rechenschwierigkeiten: Ob sich bei Kindern mit Lernschwierigkeiten hirnphysiologische Besonderheiten diagnostizieren lassen oder nicht, deren schulische Modifizierbarkeit lässt sich nur durch mathematikdidaktische und pädagogische Interventionsforschung klären (Stern, 2005).
Traditionelle Vorstellungen, die das Denken über Rechenschwierigkeiten für Jahrzehnte beeinflusst haben, konnten in der modernen neurowissenschaftlichen Forschung nicht bestätigt werden:
Solche Befunde können helfen, die Stärken und Schwächen von Heranwachsenden mit Lernschwierigkeiten differenziert zu diagnostizieren, aber sie können nicht dazu dienen, das unterrichtliche Angebot inhaltlich und methodisch gezielt zu adaptieren (Stern, 2003, 2005). Wie der Unterricht organisiert werden sollte, welche Inhalte, Medien und Methoden bei welchem Kind wie und wie lange eingesetzt werden sollten, ist nicht auf neurowissenschaftlicher Basis zu entscheiden, sondern vielmehr eine Frage guten Mathematikunterrichts und mathematikdidaktisch und pädagogisch fundierter Forschung.
Empirische Studien wie die von Kovas, Haworth, Dale und Plomin (2007) legen eine vorsichtigere und differenziertere Bewertung nahe. Zwar konnte gezeigt werden, dass Rechenschwierigkeiten familiär gehäuft auftreten und dass sich für diesen Befund ein genetischer Beitrag feststellen lässt, aber es konnten bislang keine spezifischen Gene identifiziert werden und die Überschneidungen mit Aufmerksamkeitsstörungen und mit schriftsprachlichen Lernschwierigkeiten waren sehr groß (Aster, 2005).
Grundsätzlich muss man sich ohnehin fragen, ob die Suche nach den genetischen Anteilen an der Entstehung von Rechenschwierigkeiten pädagogisch wichtig ist. Wie hoch auch immer dieser Anteil sein mag, die genetische Ausstattung eines Kindes lässt sich nicht verändern – helfen kann man den betroffenen Kindern nur mit pädagogischen Mitteln. Ob und in welchem Ausmaß sich guter, individuell angepasster Mathematikunterricht als hilfreich erweist, kann nur in mathematikdidaktischer und pädagogischer Forschung geklärt werden (Stern, 2005).
Überhaupt darf man die Ursachen von Lernschwierigkeiten nicht mit deren pädagogischer Beeinflussbarkeit verwechseln: Falls eine Störung genetische Ursachen hat, sagt das noch nichts über deren Modifizierbarkeit aus. Das gilt ebenso für die neuronalen Grundlagen von Rechenschwierigkeiten: Ob sich bei Kindern mit Lernschwierigkeiten hirnphysiologische Besonderheiten diagnostizieren lassen oder nicht, deren schulische Modifizierbarkeit lässt sich nur durch mathematikdidaktische und pädagogische Interventionsforschung klären (Stern, 2005).
Traditionelle Vorstellungen, die das Denken über Rechenschwierigkeiten für Jahrzehnte beeinflusst haben, konnten in der modernen neurowissenschaftlichen Forschung nicht bestätigt werden:
- Es gibt nicht die typischen Rechenfehler, die nur von Kindern mit Rechenschwierigkeiten gemacht würden und es lassen sich keine neuronalen Prozesse erkennen, die für Zahlendreher oder Rechenfehler verantwortlich wären.
- Für die populären Theorien von der einseitigen Dominanz einer Hirnhälfte bei Rechenschwäche bzw. von der mangelhaften Koordination zwischen den Hirnhälften lassen sich keine überzeugenden Befunde finden. Die räumliche Verteilung von Hirnaktivitäten ist weitgehend von der zu bewältigenden Aufgabe abhängig und die Kommunikation zwischen den Hirnhälften lässt sich durch Training nicht verbessern.
Solche Befunde können helfen, die Stärken und Schwächen von Heranwachsenden mit Lernschwierigkeiten differenziert zu diagnostizieren, aber sie können nicht dazu dienen, das unterrichtliche Angebot inhaltlich und methodisch gezielt zu adaptieren (Stern, 2003, 2005). Wie der Unterricht organisiert werden sollte, welche Inhalte, Medien und Methoden bei welchem Kind wie und wie lange eingesetzt werden sollten, ist nicht auf neurowissenschaftlicher Basis zu entscheiden, sondern vielmehr eine Frage guten Mathematikunterrichts und mathematikdidaktisch und pädagogisch fundierter Forschung.
Hier geht es weiter zur Diagnostik