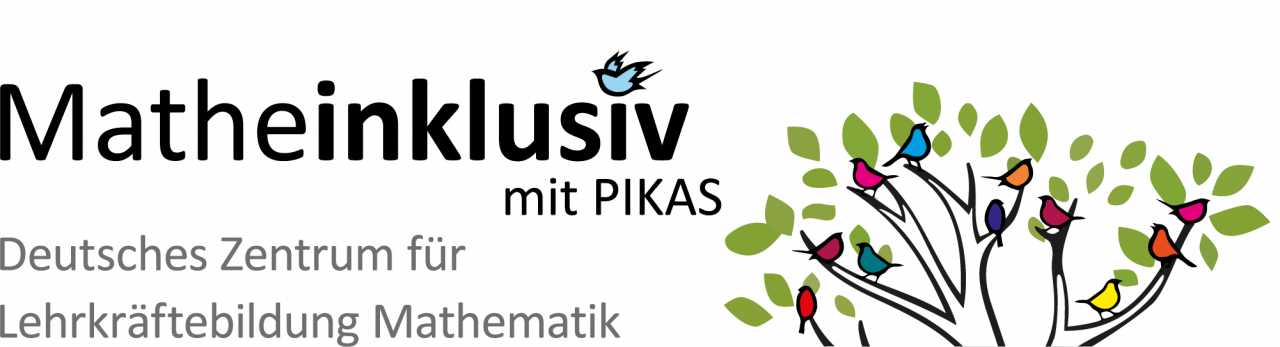Erschwerte Selbstfindung in sozialer Interaktion
In den vorherigen Teilmodulen wurden sowohl die Erscheinungsformen körperlicher Behinderungen als auch daraus resultierende Beeinträchtigungen auf der Ebene des Verhaltens dargestellt. Hervorzuheben ist, dass diese funktionellen Einschränkungen und Veränderungen nicht zwangsläufig zu einer „Be-Hinderung“ im eigentlichen Sinne führen. Viele Menschen mit einer Körperbehinderung können sich auch trotz einer körperlichen Schädigung und den daraus folgenden Verhaltensbeeinträchtigungen als nicht behindert erleben und dementsprechend handeln.
Vor dem Hintergrund der enormen Heterogenität der Erscheinungsformen lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen über die höchst komplexen und intra- sowie interindividuellen Bewertungsprozesse aus Sicht der Betroffenen ableiten (Schlüter 2010, S. 18). Ortland (2007, S. 95) beschreibt die hier gemeinten körperlichen Schädigungen zunächst neutral als Bedingungen, „die Menschen in Situationen einbringen und die von den anderen im Rahmen behindernder Prozesse als Störung oder Irritation bewertet werden“.
Die Benachteiligung bzw. Behinderung entsteht erst unter sozialem Bezug: körperliche Schädigungen und eingeschränkte Verhaltensmöglichkeiten werden erst dann zu einer tatsächlichen Behinderung der betroffenen Person, wenn sie in der direkten sozialen Interaktion oder in der öffentlichen Kommunikation negativ bewertet werden. Der Begriff der Körperbehinderung ist dementsprechend als relatives Phänomen zu betrachten. Es kann sehr wohl der Fall sein, dass die Selbstwahrnehmung der Betroffenen und die Fremdwahrnehmung ihrer Mitmenschen deutlich divergieren, auch im schulischen Kontext.

Abbildung 11: Mögliche Bereiche erschwerter Selbstfindung in der sozialen Interaktion (in Anlehnung an Leyendecker, 2005, S. 103 ff.)
Abbildung 11 zeigt die Bereiche auf der Ebene der sozialen Interaktion, die zu Behinderungen im eigentlichen Sinne führen können. Körperliche Behinderungen stellen eine Abweichung von Normvorstellungen dar, die durch das jeweilige kulturelle und gesellschaftspolitische System bestimmt werden. Auch wenn im Zuge der aktuellen Inklusionsentwicklung verstärkt ein Umdenken hinsichtlich der Heterogenität und Vielfalt der Menschen fokussiert wird, lässt sich seit jeher eine Art inoffizielles Gradmaß feststellen, das die von der Gesellschaft geduldete Verschiedenheit normt. Diese Normvorstellungen haben einen starken Einfluss auf die Einstellungen und den Kontakt zu Menschen mit Körperbehinderungen (Schlüter 2010, S. 15).
Der Grad der Behinderung, genauer gesagt der Grad der Abweichung von der gesellschaftlich geduldeten Norm, wirkt sich demnach auf die soziale Akzeptanz und Annahme der betroffenen Menschen aus. Die Reaktionen auf Menschen mit körperlichen Behinderungen hängen im Wesentlichen von der äußeren Auffälligkeit und Sichtbarkeit der körperlichen Schädigungen ab, die in Interaktionssituationen den Auslöser für Irritationen und Störungen darstellen.
Die als Abweichung von der Norm wahrgenommenen körperlichen Schädigungen werden von Menschen ohne Behinderung überwiegend negativ bewertet. Anstelle der eigentlich erwünschten Definition über die Individualität und Persönlichkeit eines Menschen tritt die Definition über einen körperlichen Defekt. Der Mensch mit einer körperlichen Behinderung wird auf dieses Merkmal reduziert, in seiner gesamten Person abgewertet und stigmatisiert, d.h. er wird anhand seines individuellen Merkmals vorverurteilt und es werden ihm nicht selten weitere negative Eigenschaften unterstellt und zugeschrieben. Daraus ergeben sich deutliche Spannungen in der sozialen Interaktion zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen, die auch als ein „ambivalenter Annäherungs- bzw. Vermeidungskonflikt“ umschrieben werden können (Leyendecker 2005, S. 103 f.).
Die Formen der Begegnung gegenüber Menschen mit Behinderungen reichen von „Mitleid“ bis „Aus-dem-Weg-Gehen“, von „Anstarren“ bis „Bevormundung“. Gleichzeitig besteht auf der Seite der betroffenen Person die berechtigte Erwartung, in ihrer ganzen Persönlichkeit Beachtung zu finden und akzeptiert zu werden. Häufig kommt es auch zu sogenannten „paradoxen Interaktionen“ (ebd., S. 106), d.h. dass das verbale und das nonverbale Verhalten auf Seiten der Person ohne Behinderung deutlich voneinander abweichen. Diese lassen sich aber vornehmlich bei Jugendlichen und Erwachsenen erkennen. Kinder zeigen oftmals einen direkteren und spontaneren Umgang, sowohl in ihrer Einfühlungsfähigkeit als auch in ihren aktiven Verhaltensweisen.
Die nachfolgende Abbildung 12 zeigt beispielhaft eine solche paradoxe Interaktionssituation und soll zum Nachdenken anregen. (Leyendecker 2005, S.106):

Stigmatisierungsprozesse lassen sich häufig auf ein Gefühl von Bedrohung sowie empfundener individueller Angst bei der stigmatisierenden Person zurückführen: Angst vor Fremdem, Ungewohntem, aber auch „Angst vor dem Verlust der eigenen Unversehrtheit“ (Schlüter 2010, S. 19), die bei der Begegnung mit einem Menschen mit einer Körperbehinderung ausgelöst werden können.
Kinder treten im Gegensatz zu vielen Erwachsenen körperlichen Behinderungsformen grundsätzlich zwar neugierig gegenüber und sie bewerten diese aufgrund fehlender Erfahrungswerte zunächst neutral (Schlüter 2010, S. 18), dennoch zeigt sich in Schule und Unterricht immer wieder, dass Lernende mit gravierenden Abweichungen in Bewegungsfähigkeit, Verhalten oder Kommunikation oftmals schlechter in die Klassengemeinschaft eingebunden werden als Kinder ohne Beeinträchtigungen (Thiele 2013, S. 26). Dies gilt insbesondere für deutlich sichtbare Schädigungen im Gesicht und an Kopf und Rumpf, bei verdrehter Körperhaltung und bei verzerrter Mimik.
Für die aktuelle Inklusionsbewegung ergibt sich im schulischen Rahmen der Auftrag, Kinder so früh wie möglich mit dem „Phänomen des körperlichen Andersseins“ (Leyendecker 2009 b, S. 45) vertraut zu machen. Das betrifft einerseits den Abbau von Ängsten und Vorurteilen gegenüber Menschen mit Körperbehinderungen, andererseits nimmt auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Individualität sowohl bei allen Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrerinnen und Lehrern eine besondere Bedeutung ein. Das frühe Bewusstsein, dass nicht alle Menschen gleich sind und dass Verschiedenheit, unabhängig von ihrer Sichtbarkeit, als „normal“ angesehen wird, ist ein zentraler Aspekt im Bereich der Körperbehinderungen und gleichzeitiges Ziel der Inklusion.
Aus Sicht der Betroffenen haben diese sozialen bzw. gesellschaftlichen Phänomene der Stigmatisierung weitreichende und oftmals verheerende Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Lebensgestaltung. Das bedeutet, dass die persönliche, individuelle Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz zusätzlich und erheblich erschwert wird durch die soziale Interaktion. Die diskreditierenden und wenig wertschätzenden Bedingungen, die diesen Menschen aufgrund ihrer körperlichen Behinderungen in sozialen Interaktionen entgegengebracht werden, führen oftmals zu einem negativen Selbstbild und einer erschwerten Selbstfindung.
Die Entwicklung des Selbstkonzeptes, d.h. die Wahrnehmung und das Wissen um die eigene Person, die wesentlich zur Selbstfindung eines Menschen beiträgt, ist bei Menschen mit Körperbehinderungen oftmals gestört. Die Selbsterfahrungen und das Selbsterleben werden bestimmt durch Erfahrungen der Etikettierung durch das soziale Umfeld sowie durch die Bindung der persönlichen Existenz an die Schädigung (Bergeest et. al. 2015, S. 210).
Dadurch unterliegen die Betroffenen deutlich erschwerten Bedingungen bei der Identitätsfindung: Die beiden Pole der persönlichen und der sozialen Identität, die von jedem Menschen in der Auseinandersetzung mit sozialen Bewertungsmaßstäben immer wieder ins Gleichgewicht gebracht werden müssen, werden bei Menschen mit einer Körperbehinderung einseitig beeinträchtigt und durch die ihnen entgegengebrachte Fremdbestimmung beeinflusst (Leyendecker 2005, S. 104). Dadurch entsteht die Gefahr, dass die Betroffenen sich in der ihnen angetragenen sozialen Identität, die durch negative Etikettierungen und Stigmatisierungen gekennzeichnet ist, verlieren, sich den gesellschaftlichen Rollenerwartungen anpassen und ihre persönliche Identität aufgeben.
Das Bemühen um soziale Akzeptanz, Anerkennung und gleichberechtigte Formen der sozialen Interaktion sowie der uneingeschränkten Selbstverwirklichung erweist sich i.d.R. als ein lebenslanger Prozess. Betroffene Menschen werden in jeder neuen Situation mit unbekannten Menschen sowie bei Veränderungen ihrer Lebenssituationen erneut herausgefordert, sich ihrer selbst zu behaupten. Daraus ergibt sich eine anspruchsvolle „Gratwanderung“ zwischen sozialer Anpassung (soziale Identität) bzw. sozialer Akzeptanz einerseits sowie Selbstbehauptung (personale Identität) andererseits (ebd., S. 105).
Die bewusste Vergegenwärtigung dieser Faktoren, die für Menschen mit körperlichen Behinderungen zu einer deutlich erschwerten Selbstfindung und zu einer hochgradig eingeschränkten sozialen Teilhabe führen können, ist eine essentielle Voraussetzung für die inklusive Schulentwicklung. Inklusion beginnt in den Köpfen.
Als Lehrperson gilt es, an dieser Stelle ein verantwortungsvolles Bewusstsein zu entwickeln und Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren. Denn nur ein bewusster und gewissenhafter Umgang kann einen wesentlichen Schritt dazu beitragen, sowohl den Schulalltag als auch den Unterricht so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Behinderung in ihrer schulischen Lebenswelt auf der sozialen Ebene möglichst uneingeschränkt und gleichberechtigt leben können. Die Zielsetzung der Inklusion, allen Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte Teilhabe am Schulleben sowie eine uneingeschränkte Entfaltung ihres Selbstwertgefühls zu ermöglichen, tritt an dieser Stelle äußerst prägnant zum Vorschein.
 oder
oder
Die Reflektion der eigenen Einstellungen und Ansichten spielt sowohl hinsichtlich des eigenen Denkens als auch des pädagogischen Handelns im gegenwärtigen schulischen Kontext für Lehrpersonen eine bedeutsame Rolle: einerseits in Bezug auf Inklusion im Allgemeinen, andererseits in Bezug auf spezifische Behinderungs- und Beeinträchtigungsformen im Speziellen. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und denken Sie über Ihre persönlichen Sichtweisen nach. Wie stehen Sie, ungeachtet der aktuellen schulpolitischen Entwicklungen, dem Aspekt der Inklusion gegenüber? Mit welchen Haltungen und Vorstellungen begegnen Sie Menschen mit körperlichen Behinderungen?
Vor dem Hintergrund der enormen Heterogenität der Erscheinungsformen lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen über die höchst komplexen und intra- sowie interindividuellen Bewertungsprozesse aus Sicht der Betroffenen ableiten (Schlüter 2010, S. 18). Ortland (2007, S. 95) beschreibt die hier gemeinten körperlichen Schädigungen zunächst neutral als Bedingungen, „die Menschen in Situationen einbringen und die von den anderen im Rahmen behindernder Prozesse als Störung oder Irritation bewertet werden“.
Die Benachteiligung bzw. Behinderung entsteht erst unter sozialem Bezug: körperliche Schädigungen und eingeschränkte Verhaltensmöglichkeiten werden erst dann zu einer tatsächlichen Behinderung der betroffenen Person, wenn sie in der direkten sozialen Interaktion oder in der öffentlichen Kommunikation negativ bewertet werden. Der Begriff der Körperbehinderung ist dementsprechend als relatives Phänomen zu betrachten. Es kann sehr wohl der Fall sein, dass die Selbstwahrnehmung der Betroffenen und die Fremdwahrnehmung ihrer Mitmenschen deutlich divergieren, auch im schulischen Kontext.

Abbildung 11: Mögliche Bereiche erschwerter Selbstfindung in der sozialen Interaktion (in Anlehnung an Leyendecker, 2005, S. 103 ff.)
Abbildung 11 zeigt die Bereiche auf der Ebene der sozialen Interaktion, die zu Behinderungen im eigentlichen Sinne führen können. Körperliche Behinderungen stellen eine Abweichung von Normvorstellungen dar, die durch das jeweilige kulturelle und gesellschaftspolitische System bestimmt werden. Auch wenn im Zuge der aktuellen Inklusionsentwicklung verstärkt ein Umdenken hinsichtlich der Heterogenität und Vielfalt der Menschen fokussiert wird, lässt sich seit jeher eine Art inoffizielles Gradmaß feststellen, das die von der Gesellschaft geduldete Verschiedenheit normt. Diese Normvorstellungen haben einen starken Einfluss auf die Einstellungen und den Kontakt zu Menschen mit Körperbehinderungen (Schlüter 2010, S. 15).
Der Grad der Behinderung, genauer gesagt der Grad der Abweichung von der gesellschaftlich geduldeten Norm, wirkt sich demnach auf die soziale Akzeptanz und Annahme der betroffenen Menschen aus. Die Reaktionen auf Menschen mit körperlichen Behinderungen hängen im Wesentlichen von der äußeren Auffälligkeit und Sichtbarkeit der körperlichen Schädigungen ab, die in Interaktionssituationen den Auslöser für Irritationen und Störungen darstellen.
Die als Abweichung von der Norm wahrgenommenen körperlichen Schädigungen werden von Menschen ohne Behinderung überwiegend negativ bewertet. Anstelle der eigentlich erwünschten Definition über die Individualität und Persönlichkeit eines Menschen tritt die Definition über einen körperlichen Defekt. Der Mensch mit einer körperlichen Behinderung wird auf dieses Merkmal reduziert, in seiner gesamten Person abgewertet und stigmatisiert, d.h. er wird anhand seines individuellen Merkmals vorverurteilt und es werden ihm nicht selten weitere negative Eigenschaften unterstellt und zugeschrieben. Daraus ergeben sich deutliche Spannungen in der sozialen Interaktion zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen, die auch als ein „ambivalenter Annäherungs- bzw. Vermeidungskonflikt“ umschrieben werden können (Leyendecker 2005, S. 103 f.).
Die Formen der Begegnung gegenüber Menschen mit Behinderungen reichen von „Mitleid“ bis „Aus-dem-Weg-Gehen“, von „Anstarren“ bis „Bevormundung“. Gleichzeitig besteht auf der Seite der betroffenen Person die berechtigte Erwartung, in ihrer ganzen Persönlichkeit Beachtung zu finden und akzeptiert zu werden. Häufig kommt es auch zu sogenannten „paradoxen Interaktionen“ (ebd., S. 106), d.h. dass das verbale und das nonverbale Verhalten auf Seiten der Person ohne Behinderung deutlich voneinander abweichen. Diese lassen sich aber vornehmlich bei Jugendlichen und Erwachsenen erkennen. Kinder zeigen oftmals einen direkteren und spontaneren Umgang, sowohl in ihrer Einfühlungsfähigkeit als auch in ihren aktiven Verhaltensweisen.
Die nachfolgende Abbildung 12 zeigt beispielhaft eine solche paradoxe Interaktionssituation und soll zum Nachdenken anregen. (Leyendecker 2005, S.106):

Stigmatisierungsprozesse lassen sich häufig auf ein Gefühl von Bedrohung sowie empfundener individueller Angst bei der stigmatisierenden Person zurückführen: Angst vor Fremdem, Ungewohntem, aber auch „Angst vor dem Verlust der eigenen Unversehrtheit“ (Schlüter 2010, S. 19), die bei der Begegnung mit einem Menschen mit einer Körperbehinderung ausgelöst werden können.
Kinder treten im Gegensatz zu vielen Erwachsenen körperlichen Behinderungsformen grundsätzlich zwar neugierig gegenüber und sie bewerten diese aufgrund fehlender Erfahrungswerte zunächst neutral (Schlüter 2010, S. 18), dennoch zeigt sich in Schule und Unterricht immer wieder, dass Lernende mit gravierenden Abweichungen in Bewegungsfähigkeit, Verhalten oder Kommunikation oftmals schlechter in die Klassengemeinschaft eingebunden werden als Kinder ohne Beeinträchtigungen (Thiele 2013, S. 26). Dies gilt insbesondere für deutlich sichtbare Schädigungen im Gesicht und an Kopf und Rumpf, bei verdrehter Körperhaltung und bei verzerrter Mimik.
Für die aktuelle Inklusionsbewegung ergibt sich im schulischen Rahmen der Auftrag, Kinder so früh wie möglich mit dem „Phänomen des körperlichen Andersseins“ (Leyendecker 2009 b, S. 45) vertraut zu machen. Das betrifft einerseits den Abbau von Ängsten und Vorurteilen gegenüber Menschen mit Körperbehinderungen, andererseits nimmt auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Individualität sowohl bei allen Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrerinnen und Lehrern eine besondere Bedeutung ein. Das frühe Bewusstsein, dass nicht alle Menschen gleich sind und dass Verschiedenheit, unabhängig von ihrer Sichtbarkeit, als „normal“ angesehen wird, ist ein zentraler Aspekt im Bereich der Körperbehinderungen und gleichzeitiges Ziel der Inklusion.
Aus Sicht der Betroffenen haben diese sozialen bzw. gesellschaftlichen Phänomene der Stigmatisierung weitreichende und oftmals verheerende Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Lebensgestaltung. Das bedeutet, dass die persönliche, individuelle Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz zusätzlich und erheblich erschwert wird durch die soziale Interaktion. Die diskreditierenden und wenig wertschätzenden Bedingungen, die diesen Menschen aufgrund ihrer körperlichen Behinderungen in sozialen Interaktionen entgegengebracht werden, führen oftmals zu einem negativen Selbstbild und einer erschwerten Selbstfindung.
Die Entwicklung des Selbstkonzeptes, d.h. die Wahrnehmung und das Wissen um die eigene Person, die wesentlich zur Selbstfindung eines Menschen beiträgt, ist bei Menschen mit Körperbehinderungen oftmals gestört. Die Selbsterfahrungen und das Selbsterleben werden bestimmt durch Erfahrungen der Etikettierung durch das soziale Umfeld sowie durch die Bindung der persönlichen Existenz an die Schädigung (Bergeest et. al. 2015, S. 210).
Dadurch unterliegen die Betroffenen deutlich erschwerten Bedingungen bei der Identitätsfindung: Die beiden Pole der persönlichen und der sozialen Identität, die von jedem Menschen in der Auseinandersetzung mit sozialen Bewertungsmaßstäben immer wieder ins Gleichgewicht gebracht werden müssen, werden bei Menschen mit einer Körperbehinderung einseitig beeinträchtigt und durch die ihnen entgegengebrachte Fremdbestimmung beeinflusst (Leyendecker 2005, S. 104). Dadurch entsteht die Gefahr, dass die Betroffenen sich in der ihnen angetragenen sozialen Identität, die durch negative Etikettierungen und Stigmatisierungen gekennzeichnet ist, verlieren, sich den gesellschaftlichen Rollenerwartungen anpassen und ihre persönliche Identität aufgeben.
Das Bemühen um soziale Akzeptanz, Anerkennung und gleichberechtigte Formen der sozialen Interaktion sowie der uneingeschränkten Selbstverwirklichung erweist sich i.d.R. als ein lebenslanger Prozess. Betroffene Menschen werden in jeder neuen Situation mit unbekannten Menschen sowie bei Veränderungen ihrer Lebenssituationen erneut herausgefordert, sich ihrer selbst zu behaupten. Daraus ergibt sich eine anspruchsvolle „Gratwanderung“ zwischen sozialer Anpassung (soziale Identität) bzw. sozialer Akzeptanz einerseits sowie Selbstbehauptung (personale Identität) andererseits (ebd., S. 105).
Die bewusste Vergegenwärtigung dieser Faktoren, die für Menschen mit körperlichen Behinderungen zu einer deutlich erschwerten Selbstfindung und zu einer hochgradig eingeschränkten sozialen Teilhabe führen können, ist eine essentielle Voraussetzung für die inklusive Schulentwicklung. Inklusion beginnt in den Köpfen.
Als Lehrperson gilt es, an dieser Stelle ein verantwortungsvolles Bewusstsein zu entwickeln und Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren. Denn nur ein bewusster und gewissenhafter Umgang kann einen wesentlichen Schritt dazu beitragen, sowohl den Schulalltag als auch den Unterricht so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Behinderung in ihrer schulischen Lebenswelt auf der sozialen Ebene möglichst uneingeschränkt und gleichberechtigt leben können. Die Zielsetzung der Inklusion, allen Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte Teilhabe am Schulleben sowie eine uneingeschränkte Entfaltung ihres Selbstwertgefühls zu ermöglichen, tritt an dieser Stelle äußerst prägnant zum Vorschein.
Die Reflektion der eigenen Einstellungen und Ansichten spielt sowohl hinsichtlich des eigenen Denkens als auch des pädagogischen Handelns im gegenwärtigen schulischen Kontext für Lehrpersonen eine bedeutsame Rolle: einerseits in Bezug auf Inklusion im Allgemeinen, andererseits in Bezug auf spezifische Behinderungs- und Beeinträchtigungsformen im Speziellen. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und denken Sie über Ihre persönlichen Sichtweisen nach. Wie stehen Sie, ungeachtet der aktuellen schulpolitischen Entwicklungen, dem Aspekt der Inklusion gegenüber? Mit welchen Haltungen und Vorstellungen begegnen Sie Menschen mit körperlichen Behinderungen?
Hier geht es weiter zu charakteristischen Merkmalen